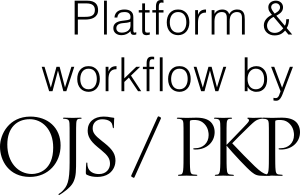Władze Królestwa Polskiego wobec paulinów polskich (1815—1864) Zarys problematyki
Słowa kluczowe:
historia zakonu Paulinów, Królestwo Polskie, władze rosyjskie i Kościół katolickiAbstrakt
In dem Zeitraum 1815—1864 befanden sich die meisten Paulinerklöster innerhalb des Königreichs Polen (nur der Paulinerkloster auf dem Skałkahügel in Krakau lag außerhalb des Königreichs). Die Obrigkeit des Königreichs Polen hatte Abneigung gegen kontemplative Orden, weil diese — ihrer Meinung nach — der Bevölkerung keinen Nutzen brachten. Die Pauliner haben jedoch in ihren Gebäuden Pfarreien geführt, was missgünstige Beziehung der damaligen Eliten zu dem Orden ein wenig entschärfte. Im Jahre 1818 haben die Pauliner den Kloster in Wieluń (dt.: Welun) und im Jahre 1819 sieben weitere Klöster verloren, welche von staatlichen und kirchlichen Behörden aufgelöst wurden. In den nächsten Jahren hat der Orden seinen Kloster in Wielgomłyny und nach langjährigen Bemühungen, im Jahre 1860 auch den Kloster in Brdów (dt.: Seestetten) wiedergewonnen. Die Paulinerklöster waren unter staatlicher und diözesaner Aufsicht. Es kam zu den durch Aufnahme in den Orden bedingten Streiten und sogar zur Beschlagnahme der Klosterurkunden. Staatliche Aufsicht umfasste auch den wirtschaftlichen Bereich.
Die Pauliner haben sich aktiv an dem Novemberaufstand beteiligt, indem sie den aufständischen Behörden Spende gaben und Soldaten für Abteilungen der Aufständischen auf eigene Kosten aufstellten. Nach dem Aufstand hat sich die Lage des Ordens verschlimmert. Nikolaus I. hat zwar das Kriegsrecht über das Land verhängt, was die Verlegung von Mönchen zwischen den Klöstern sehr erschwerte. Der Prozess des Eintritts in den Orden und wirtschaftliche Sachen wurden vom Staatsapparat noch genauer überprüft. Die in den Jahren 1861—1864 stattfindenden Ereignisse haben die Pauliner sehr beschäftigt. Sie veranstalteten damals zahlreiche patriotische Gottesdienste und Klerusversammlungen. Einige Mönche übten die Funktion der aufständischen Kapläne aus, manche waren an der Untergrundbewegung aktiv beteiligt. Es sind auch solche Fälle bekannt, dass die paulinischen Priesterseminaristen zur Waffe griffen. Als Vergeltung für diese Tätigkeit hat zaristische Obrigkeit im Jahre 1864 alle Paulinerklöster, der Kloster Jasna Góra in Częstochowa (dt.: Klarenberg in Tschenstochau) ausgenommen, aufgelöst.
Pobrania
Opublikowane
Jak cytować
Numer
Dział
Licencja
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.
1. Licencja
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.
2. Oświadczenie Autora
Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.
Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.
UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).
3. Prawa użytkownika
Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.
4. Współautorstwo
Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.
Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).